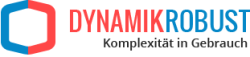Frau Rebstocks Ho-Chi-Minh-Pfad
3. März 2017 - Ralf Hildebrandt
Unseren treuen Leserinnen und Lesern ist der folgende Abschnitt nicht neu. Aber es kommen jede Woche neue hinzu. Deshalb ein kurzer Vorspann.
Hat ein Unternehmen eine bestimmte Größe erreicht, zerlegt es sich bei steigender Komplexität in Zentrum und Peripherie. Diese ungewollte Struktur entsteht hinter dem Rücken der Akteure. Auf Marktreize reagieren dann nur noch die peripheren Funktionen. Das Zentrum verliert seinen Kompetenzvorsprung und die Steuerung bricht zusammen. Wohlgemerkt geschieht das unbemerkt. Und was im Dunkeln bleibt, hat sicher keine Chance auf Lösung.
Unter anderem ist das ist der Grund, weshalb so manche(r) Konzern-Angestellte(r) dieser Tage den Eindruck bekommt, dass sich die Schlagzahl der Change-Initiativen aus dem Zentrum erhöht. Das ist für beide Seiten tragisch. Denn es läuft immer auf dasselbe hinaus: man versucht unter steigendem Druck die Unternehmenssteuerung zu reparieren, obwohl die gar nicht kaputt ist.
Nun zu unserer heutigen Geschichte.
Frau Rebstock ist eine Managerin um die 40. Sie hat schon viel erlebt. Sie treibt sich tagtäglich auf dem Minenfeld zwischen Zentrum und Peripherie herum. Jede Woche balanciert sie auf dem Drahtseil und wandert zwischen beiden Funktionen umher. Mal liefert sie mit pflichtschuldigem Blick die Zahlen und Reports ab, die man sehen möchte. Mal unterstützt sie ihre Leute in der Arbeit am Markt und schlägt der Konkurrenz ein Schnippchen.
Man hatte sich in ihrer Abteilung daran gewöhnt, dass im Schnitt alle 1,7 Jahre das nächste Kostensenkungsprogramm von oben heruntertröpfelte. Denn sie arbeitet in einem überlasteten Konzern und da trägt man sein Schicksal gemeinsam. Läuft es gut, profitieren alle – Gießkanne. Läuft es irgendwo nicht so recht, büßen alle. Rasenmäher.
Lange Jahre lief es gut. In jüngerer Zeit nicht mehr. Und so kommt es immer einmal wieder zu Kostensenkungsprogrammen. Die sich im Kern ähnlich sind, aber immer anders heißen. Efficiency-…, Flexibility-…, Performance-… Future-… . Jedenfalls hat man die Erfahrung gemacht, dass 80% davon letztlich mit einem Stellenabbau verbunden sind. Wo immer möglich sozialverträglich. Versteht sich.
Vor ein paar Jahren hatte Frau Rebstock noch einen Manager „über“ sich, der hatte noch etwas vom Geschäft (vom Markt) verstanden. Das Gefühl für das, was Erfolg ausmacht, war ihrem ähnlich. Der Schutzraum war intakt. Erfolg war nicht, wenn in einem Spreadsheet im abgedunkelten Meeting-Raum eine Zahl (KPI) größer oder kleiner wurde. Irgendwie hatte man immer die Kunden und die Konkurrenz im Blick behalten und den „Zahlen“ vorangestellt. So war auch beiden klar, dass es einen himmelweiten Unterschied zwischen Kostensenkung und Optimierung der Wertschöpfung gibt.
Frau Rebstock führt (und steuert) eine Abteilung, welche den Kunden Dienstleistungen anbietet. Was die Kunden bezahlen, ist die (nach Kompetenz) gewichtete Zeit ihrer Leute. So direkt steht es zwar nicht auf der Rechnung. Aber nichts anderes steckt dahinter. Und weil die Abteilung einen guten Job gemacht hat, sind auch die Kosten gestiegen (wer hat da gezuckt?) – man hat mehr Leute eingestellt. Im gleichen Zeitraum sind allerdings auch die Gewinne um das Doppelte gewachsen! Kosten und Gewinn hat man in Relation zueinander betrachtet. Bezogen auf den eigenen Bereich. Ganz klar. Am Ende einer Berichtsperiode wurden dem Headquarter im Ausland die Zahlen präsentiert, die man sehen wollte. Und die Kunden in Deutschland waren auch guter Laune.
Eine hohe Kunst.
Inzwischen hat die Marktdynamik das Unternehmen noch weiter entzweit. Der Abstand zwischen Zentrum und Peripherie ist so groß geworden, dass man faktisch 2 Sprachen spricht – ein Zentrums-Englisch und ein Peripherie-Englisch. Linguistisch gesehen ist das ein Sprache. Aber die Bedeutungen sind grundverschieden. Das Argument der guten Zahlen zählt nichts mehr. Es gelingt kaum mehr, die eigene Arbeit in Relation zur bezahlten Rechnung so darzustellen, dass anderswo verstanden wird. Aus der Ferne sieht man nur die gestiegenen Kosten. Und die müssen ´runter. Das weiß doch jeder.
Auf die Idee, dass da eine Abteilung ihre Arbeit selbst in Referenz zur abgerechneten Leistung am Markt organisiert hat, kommt niemand. Diese kleinen Leute? Mit 35.000€ brutto? Wie sollen die das bewerkstelligt haben? Das war dann doch eher Zufall. Gesteigerte Gewinne sind sicher nicht die Sache der kleinen Leute. Im Übrigen geht die das auch nichts an.
Stattdessen geht man klammheimlich davon aus, dass man noch einmal 30% (damit echte 15% drin sind) herausholen kann, wenn man sich nur anstrengt. Der Grund ist, dass die eben einfach nicht so wollen, wie sie sollen. Jeder kann sich immer noch ein bisschen mehr anstrengen. Das kann man problemlos einfordern. Also kommt es darauf an, dass man Frau Rebstock davon überzeugt. Damit sie ihre Mitarbeiterschaft überzeugt.
Nach der zweiten Kostensenkungsrunde war Frau Rebstocks Rasen so kurz gestutzt, dass er in der Hitze des Marktumfeldes kaum mehr Reserven hatte und vor der Austrocknung stand. Auch sie musste Stellen abbauen – schließlich steht man als Konzern zusammen. Die Arbeit, die anfällt ist natürlich nicht weniger geworden. Nun ja – man verdient gemeinsam in den guten Zeiten und leidet gemeinsam in den schlechten. One Company!
Das konnte man eine Weile lang ertragen. Sie hatten gerade die letzte Runde verdaut. Aber jetzt steht schon die nächste an. Die Ruhephasen zwischen den Kostensenkungsprogrammen scheinen bald nicht mehr groß genug, damit sie wieder Leute aufbauen kann, die die (sehr gut bezahlte!) Arbeit erledigen. Das ist ein Zwickmühle.
Was bleibt nun?
Noch ist ihr (und ihren Leuten) immer etwas eingefallen. Das Rennen ist noch nicht gelaufen. In den Lücken kann man immer etwas Vernünftiges machen. Irgendetwas, was im Horizont der Rationalisierung gar nicht sichtbar ist. Das hängt dann sehr von den Leuten ab, mit welchen man es tagtäglich zu tun hat. Wen kennt man, was kann man mit dem anfangen, wie groß ist der noch vorhandene Schutzraum. Wo sind die Lücken, wo kann man noch durchschlüpfen? Denn natürlich können die Zentralisten nicht alles sehen. Und das kann man natürlich ausnutzen.

Der Ho-Chi-Minh-Pfad war die lebenswichtige Versorgungsroute von Nord-nach Südvietnam. In großen Teilen war die Route wie ein mäandrierender Fluss. Mit parallelen Wegen, Abzweigen und Alternativen.
Jeder wusste, dass es sie gab. Niemand wusste jedoch, wo sie genau verlief. Selbst wenn man sie jeden Tag benutzt hatte, musste man sich ständig vor Ort nach dem gerade besten Weg durch Sümpfe, überschwemmtes oder vermintes Land erkunden.
Eine großartige Leistung. Maximale Transportleistung ohne festgelegte Route. Man musste jeden Tag aufs Neue schauen, wo sich eine Lücke zeigte. Da schlüpfte man dann durch. Manchmal musste man warten, bis sich eine auftat. Das war der Vorteil derer, die sich jeden Tag im Dschungel bewegen. Denn nur sie konnten den „Locals“ glaubhaft machen, dass man dazugehört und hatten so die Chance auf Vertrauen. Um die notwendigen Kenntnisse zu erhalten. Wo es weiterging.
Bis übernächste Woche!
PS: Wünschenswert ist immer eine offene Doppelstrategie. D.h. Zentrumsfunktionen und Peripherie verbünden sich zum Nutzen des Unternehmens gegen die Struktur, die man sich eingehandelt hat. Denn niemand kann etwas dafür. Weder die Vorstände und Geschäftsführer, noch die Mitarbeiter. Wenn der Druck aber so groß wie in unserer Geschichte wird, kommt es zu solchen Bündnissen nicht mehr. Dann hilft ein Blick nach Fernost.
 Der Inhalt des Posts ist lizenziert CC-BY-NC-ND. Er kann gerne jederzeit unter Namensnennung und Link zu nicht-kommerziellen Zwecken genutzt werden.
Der Inhalt des Posts ist lizenziert CC-BY-NC-ND. Er kann gerne jederzeit unter Namensnennung und Link zu nicht-kommerziellen Zwecken genutzt werden.
Bildnachweis: iStock photo ©nadiasphoto 508884394
Neue Blogposts gibt es 2-wöchentlich. Wenn Sie möchten, bestellen Sie die Beiträge hier kostenlos:
Newsletter
Alle Blogposts bequem per E-Mail: